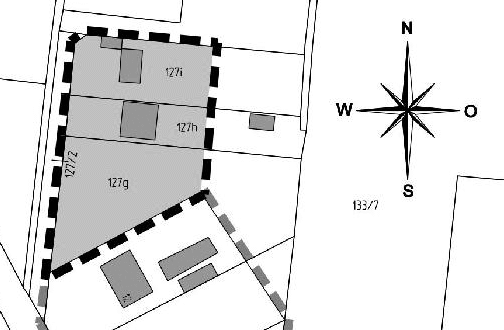Anfang 2025 geht für gesetzlich Krankenversicherte die neue elektronische Patientenakte (ePA) an den Start. Sie soll die Behandlung der Patient*innen verbessern und die Arzneimittelverschreibung sicherer machen. Derzeit verschicken die Krankenkassen Briefe an die Versicherten, in denen sie über die konkreten Neuerungen der ePA informieren. Besonders intensiv sollten die Versicherten sich dabei mit den Informationen zu ihren Widerspruchsmöglichkeiten beschäftigen, rät die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in NRW, Bettina Gayk. Denn die seien kompliziert geraten – und beträfen auch besonders sensible Behandlungsdaten.
04.11.2024 Gayk: „Versicherte sollten sich rechtzeitig mit der neuen ePA vertraut machen und dann sorgfältig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie von ihren komplexen Widerspruchsmöglichkeiten Gebrauch machen. Andernfalls wird die ePA automatisch eingerichtet und mit Informationen befüllt, die Patient*innen womöglich nicht offenlegen wollen.“
Das neue Digital-Gesetz (DigiG) sieht vor, dass die Krankenkassen Anfang 2025 für alle gesetzlich Versicherten auch ohne deren ausdrückliches Einverständnis eine elektronische Patientenakte (ePA) anlegen. Ärzt*innen und Krankenhäuser etwa sind künftig verpflichtet, dort bestimmte Daten zu speichern, wenn diese bei einer Behandlung erhoben wurden. Hierzu gehören Befunde, Arztbriefe, Berichte im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung sowie Informationen, um die Verschreibung von Medikamenten digital zu überwachen und zu steuern. Auch Abrechnungsdaten der Krankenkassen werden automatisch in die ePA übertragen. Außerdem können Versicherte ihre ePA selbst mit Dokumenten, Arztbriefen und Befunden befüllen.
Die behandelnden Ärzt*innen erhalten zugleich standardmäßig Zugriff auf alle Inhalte der ePA ihrer gesetzlich versicherten Patient*innen. Einer Einwilligung der oder des Betroffenen bedarf es nicht. Sobald die elektronische Gesundheitskarte vor Ort in der Praxis als Nachweis der Behandlung eingelesen wird, steht die ePA den behandelnden Ärzt*innen grundsätzlich für 90 Tage zur Verfügung.
„Neu ist auch, dass die in der ePA gespeicherten Daten ab Mitte 2025 ohne Einwilligung der Versicherten an das sogenannte Forschungsdatenzentrum übertragen werden können. Von dort aus können sie pseudonymisiert für die Forschung abgerufen werden“, erläutert die Landesdatenschutzbeauftragte.
Den Versicherten steht zwar das Recht zu, der Einrichtung der Akte zu widersprechen. In bestimmtem Umfang können sie auch noch später die Aufnahme von Informationen in eine bereits eingerichtete ePA stoppen. Auch können Sie Zugriffs- bzw. Einsichtnahmerechte der behandelnden Ärzt*innen einschränken und der wissenschaftlichen Nutzung ihrer Daten widersprechen. Allerdings sind hier die Möglichkeiten sehr differenziert und komplex.
So kann manchen Funktionen nur grundsätzlich widersprochen werden. Das gilt etwa im Falle von e-Rezept-Daten oder Abrechnungsdaten. Bei anderen Informationen funktioniert der Widerspruch dagegen auch im konkreten Einzelfall. Die Beauftragte empfiehlt daher, sich bereits jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen – insbesondere auch mit Blick darauf, an welche Stelle der jeweilige konkrete Widerspruch zu richten ist. „Das variiert – je nachdem, worauf sich der Widerspruch richtet“, so Gayk. „Der Widerspruch gegen die Anlage einer ePA ist etwa direkt an die jeweilige Krankenkasse zu richten. Andere Widersprüche können nach Einrichtung der ePA unmittelbar über die zugehörige App wahrgenommen werden.“
Alternativ können sich Versicherte, die keine App nutzen wollen, in vielen Fällen an speziell von den Krankenkassen einzurichtende Ombudsstellen wenden. Dem Einstellen von Behandlungsdaten müssen Versicherte wiederum gegenüber den behandelnden Ärzt*innen oder anderen Gesundheitsdienstleistern widersprechen. E-Rezept-Daten finden nur dann keinen Eingang in die ePA, wenn ihrer Übertragung generell über die ePA-App oder gegenüber der Ombudsstelle der Krankenkasse widersprochen wird.
Gayk ist deshalb wichtig hervorzuheben: „Obwohl der Gesetzgeber bei der Regelung der neuen ePA auf die bisher notwendige Einwilligung der Versicherten verzichtet hat, können diese weiterhin Einfluss auf die Verarbeitung ihrer Gesundheits- und Behandlungsdaten nehmen. Wenn sie sich frühzeitig über ihre Widerspruchsmöglichkeiten informieren, können sie ihr Selbstbestimmungsrecht weiterhin wirksam und eigenverantwortlich wahrnehmen.“
Eine gute Übersicht zu Ihren Widerspruchsrechten finden Sie auch hier www.aidshilfe.de/medien/md/epa/widerspruch-epa/ – wichtig vor allem für Menschen, die stigmatisierende Diagnosen nicht transparent machen wollen.
Quelle: www.ldi.nrw.de/ePa_Widerspruch
04.11.2024 Gayk: „Versicherte sollten sich rechtzeitig mit der neuen ePA vertraut machen und dann sorgfältig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie von ihren komplexen Widerspruchsmöglichkeiten Gebrauch machen. Andernfalls wird die ePA automatisch eingerichtet und mit Informationen befüllt, die Patient*innen womöglich nicht offenlegen wollen.“
Das neue Digital-Gesetz (DigiG) sieht vor, dass die Krankenkassen Anfang 2025 für alle gesetzlich Versicherten auch ohne deren ausdrückliches Einverständnis eine elektronische Patientenakte (ePA) anlegen. Ärzt*innen und Krankenhäuser etwa sind künftig verpflichtet, dort bestimmte Daten zu speichern, wenn diese bei einer Behandlung erhoben wurden. Hierzu gehören Befunde, Arztbriefe, Berichte im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung sowie Informationen, um die Verschreibung von Medikamenten digital zu überwachen und zu steuern. Auch Abrechnungsdaten der Krankenkassen werden automatisch in die ePA übertragen. Außerdem können Versicherte ihre ePA selbst mit Dokumenten, Arztbriefen und Befunden befüllen.
Die behandelnden Ärzt*innen erhalten zugleich standardmäßig Zugriff auf alle Inhalte der ePA ihrer gesetzlich versicherten Patient*innen. Einer Einwilligung der oder des Betroffenen bedarf es nicht. Sobald die elektronische Gesundheitskarte vor Ort in der Praxis als Nachweis der Behandlung eingelesen wird, steht die ePA den behandelnden Ärzt*innen grundsätzlich für 90 Tage zur Verfügung.
„Neu ist auch, dass die in der ePA gespeicherten Daten ab Mitte 2025 ohne Einwilligung der Versicherten an das sogenannte Forschungsdatenzentrum übertragen werden können. Von dort aus können sie pseudonymisiert für die Forschung abgerufen werden“, erläutert die Landesdatenschutzbeauftragte.
Den Versicherten steht zwar das Recht zu, der Einrichtung der Akte zu widersprechen. In bestimmtem Umfang können sie auch noch später die Aufnahme von Informationen in eine bereits eingerichtete ePA stoppen. Auch können Sie Zugriffs- bzw. Einsichtnahmerechte der behandelnden Ärzt*innen einschränken und der wissenschaftlichen Nutzung ihrer Daten widersprechen. Allerdings sind hier die Möglichkeiten sehr differenziert und komplex.
So kann manchen Funktionen nur grundsätzlich widersprochen werden. Das gilt etwa im Falle von e-Rezept-Daten oder Abrechnungsdaten. Bei anderen Informationen funktioniert der Widerspruch dagegen auch im konkreten Einzelfall. Die Beauftragte empfiehlt daher, sich bereits jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen – insbesondere auch mit Blick darauf, an welche Stelle der jeweilige konkrete Widerspruch zu richten ist. „Das variiert – je nachdem, worauf sich der Widerspruch richtet“, so Gayk. „Der Widerspruch gegen die Anlage einer ePA ist etwa direkt an die jeweilige Krankenkasse zu richten. Andere Widersprüche können nach Einrichtung der ePA unmittelbar über die zugehörige App wahrgenommen werden.“
Alternativ können sich Versicherte, die keine App nutzen wollen, in vielen Fällen an speziell von den Krankenkassen einzurichtende Ombudsstellen wenden. Dem Einstellen von Behandlungsdaten müssen Versicherte wiederum gegenüber den behandelnden Ärzt*innen oder anderen Gesundheitsdienstleistern widersprechen. E-Rezept-Daten finden nur dann keinen Eingang in die ePA, wenn ihrer Übertragung generell über die ePA-App oder gegenüber der Ombudsstelle der Krankenkasse widersprochen wird.
Gayk ist deshalb wichtig hervorzuheben: „Obwohl der Gesetzgeber bei der Regelung der neuen ePA auf die bisher notwendige Einwilligung der Versicherten verzichtet hat, können diese weiterhin Einfluss auf die Verarbeitung ihrer Gesundheits- und Behandlungsdaten nehmen. Wenn sie sich frühzeitig über ihre Widerspruchsmöglichkeiten informieren, können sie ihr Selbstbestimmungsrecht weiterhin wirksam und eigenverantwortlich wahrnehmen.“
Eine gute Übersicht zu Ihren Widerspruchsrechten finden Sie auch hier www.aidshilfe.de/medien/md/epa/widerspruch-epa/ – wichtig vor allem für Menschen, die stigmatisierende Diagnosen nicht transparent machen wollen.
Quelle: www.ldi.nrw.de/ePa_Widerspruch